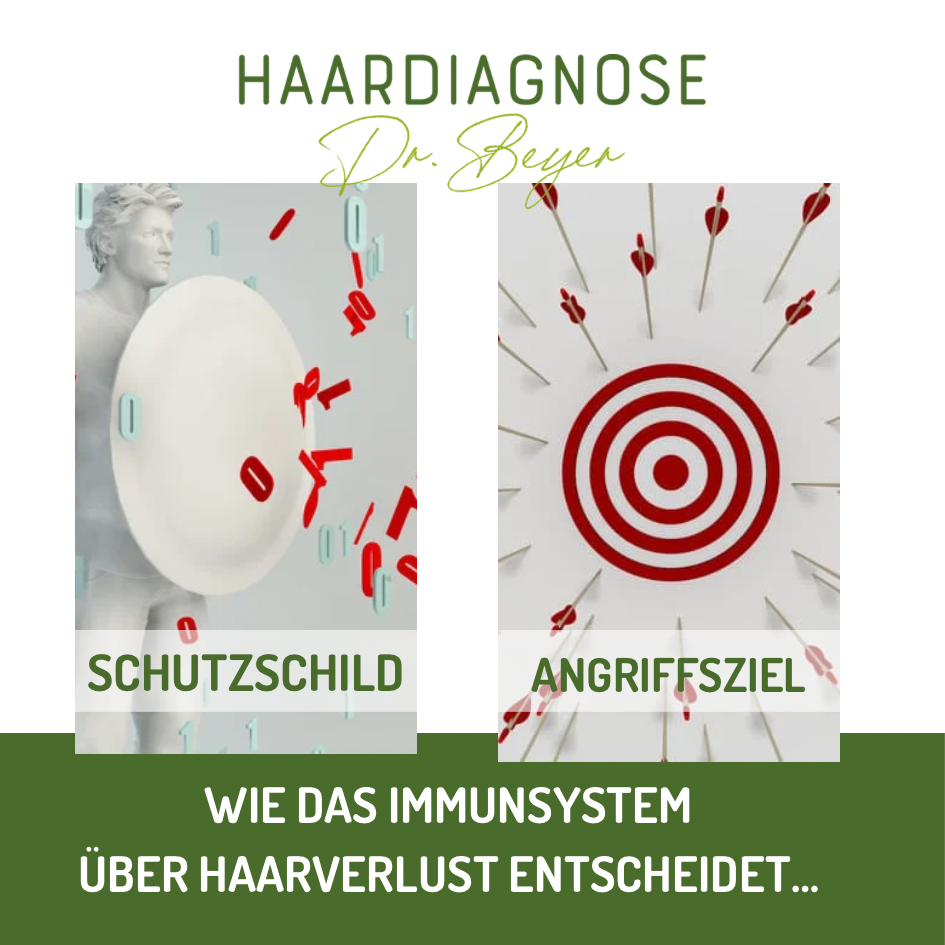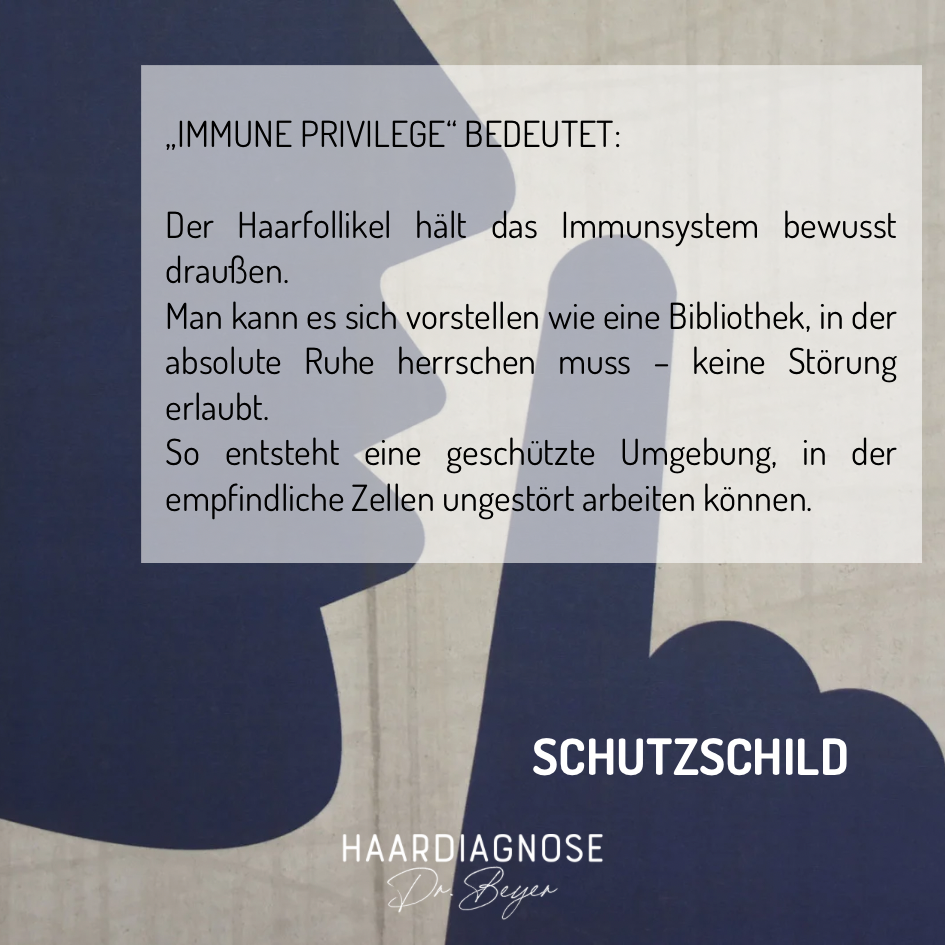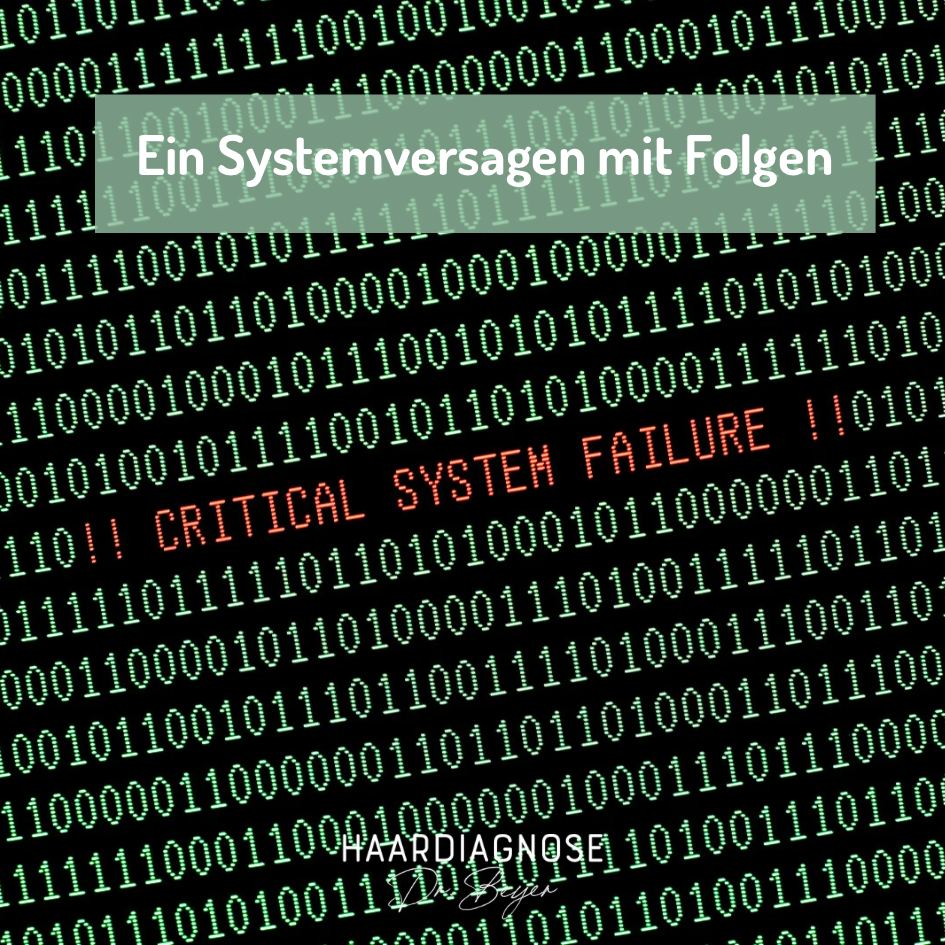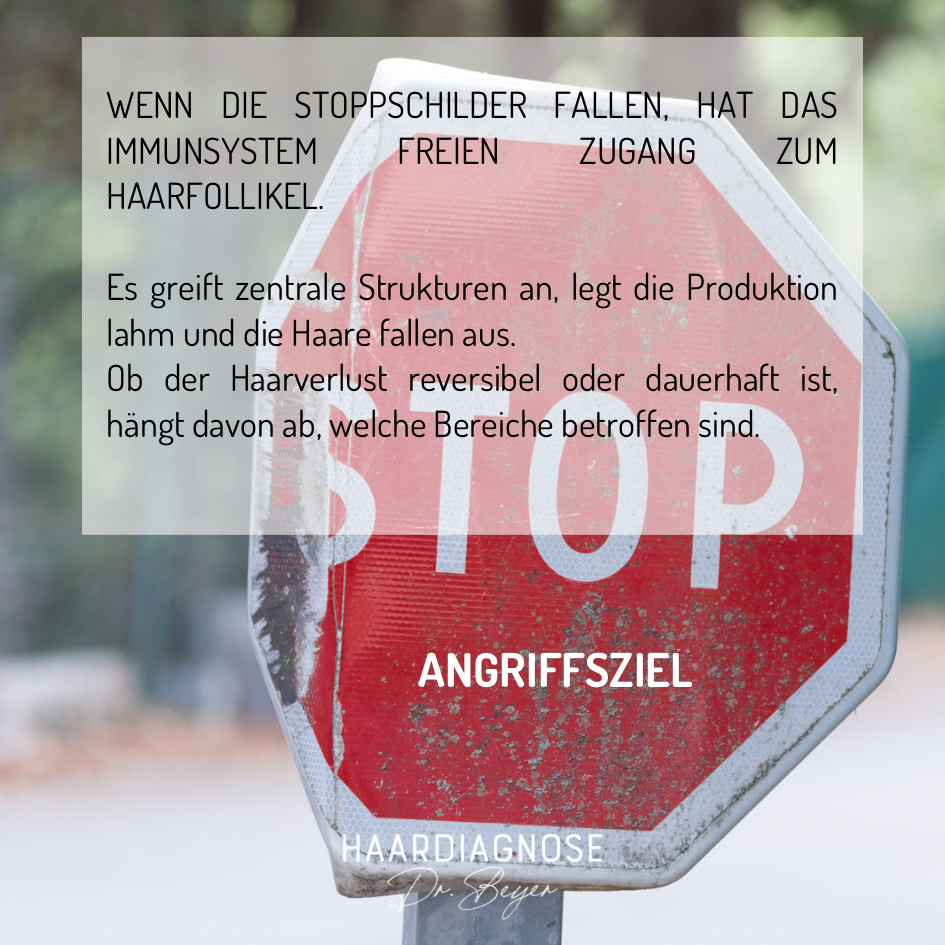Schutzschild oder Angriffsziel? Wie das Immunsystem über Haarverlust entscheidet
Unser Immunsystem ist ständig aktiv – es patrouilliert durch den Körper, immer auf der Suche nach Infektionen oder Eindringlingen. Doch an einigen besonders empfindlichen Stellen gilt: „Zutritt verboten“. Dort wird das Immunsystem bewusst ferngehalten. Diese besonderen Schutzbereiche nennt man „immune privilege“.
Dazu gehören bestimmte Strukturen im Auge, Teile des gynäkologischen Traktes – und auch die Haarfollikel.
Was bedeutet „immune privilege“?
Man kann es sich vorstellen wie eine Bibliothek:
Alles muss still sein, keine Ablenkung, keine Störung. So wie in einer Bibliothek keine lauten Gespräche erlaubt sind, darf das Immunsystem in diesem Bereich nicht patrouillieren und Zellen überprüfen.
Dieses Privileg entsteht auf verschiedene Weisen:
• Fehlende Immun-Marker: Bestimmte Moleküle, die Immunzellen normalerweise anlocken würden, fehlen.
• Beruhigende Signale: Haarfollikel produzieren Botenstoffe, die Immunzellen aktiv bremsen.
• Stoppschilder: Das Ergebnis ist eine Zone, in der das Immunsystem bewusst draußen gehalten wird.
So entsteht eine geschützte Umgebung, in der empfindliche Strukturen ungestört arbeiten können. Der Follikel investiert enorme Energie in diesen Schutz – ein Hinweis, wie bedeutsam Haare biologisch sind.
Bulbus und Bulge – die besonders geschützten Zonen
Zwei Regionen des Haarfollikels sind besonders auf Immunschutz angewiesen:
• Der Bulbus tief in der Dermis: Er ist die eigentliche „Produktionsstätte“ des Haares. Hier teilen sich die Matrixzellen – die am schnellsten wachsenden Zellen des Körpers – und bilden den Haarschaft. Die dermale Papille steuert diesen Prozess als „Schaltzentrale“ mit ihren Signalen und Wachstumsfaktoren. Melanozyten liefern die Pigmente, und in der Haarschaftbildungszoneentsteht die sichtbare Haarfaser.
• Der Bulge im Isthmus: In dieser Stammzellnische sitzen die Stammzellen, die für das Nachwachsen neuer Haare unverzichtbar sind.
Diese beiden Zonen sind durch das immune privilege besonders stark geschützt – denn wenn sie zerstört werden, ist der Haarverlust dauerhaft.
Wenn die Stoppschilder fallen
Vernarbende Alopezien
Bei vernarbenden Alopezien wie Lichen planopilaris (LPP) und Frontal fibrosing alopecia (FFA) verschwinden die Stoppschilder im Bereich des Bulge. Das Immunsystem erhält freien Zugang zu den Stammzellen. Werden sie zerstört, kann kein neues Haar mehr entstehen – der Haarverlust ist irreversibel.
Alopecia areata
Bei der Alopecia areata fällt das Schutzsystem dagegen im Bulbus. Das Immunsystem „stürmt hinein“ und greift Matrixzellen, dermale Papille und Pigmentzellen an. Die Schaltzentrale wird lahmgelegt, die Haarproduktion bricht abrupt ab, die Haare fallen aus.
Doch ein entscheidender Unterschied bleibt: Die Stammzellen im Bulge bleiben unversehrt. Sobald die Entzündung zurückgeht, kann der Follikel regenerieren. Deshalb ist Alopecia areata grundsätzlich reversibel.
Ein Systemversagen mit Folgen
Forschende sprechen vom „Verlust des immune privilege“. Normalerweise herrscht im Haarfollikel Stille und Ordnung wie in einer Bibliothek. Wenn die Stoppschilder aber entfernt werden, kommt es zu Chaos: Das Immunsystem erhält Zugang und greift an.
• Bei Alopecia areata bedeutet das meist einen vorübergehenden Haarausfall – reversibel, weil die Stammzellen intakt bleiben.
• Bei vernarbenden Alopezien wie LPP und FFA kommt es dagegen zur dauerhaften Zerstörung der Stammzellen – der Haarverlust ist irreversibel.
Warum dieser Schutz zusammenbricht, ist bis heute nicht vollständig verstanden. Doch klar ist: Je besser wir verstehen, wer die Stoppschilder entfernt, desto gezielter können wir Autoimmunerkrankungen wie Alopecia areata, LPP oder FFA behandeln – und vielleicht eines Tages verhindern.
Und vielleicht liegt in diesem außergewöhnlichen Schutz, den der Körper dem Haarfollikel widmet, noch mehr verborgen. Es zeigt, dass Haare für den Organismus eine größere Bedeutung haben, als wir lange dachten.
Vielleicht gibt es in den Haarfollikeln tatsächlich noch „mehr Magie“ zu entdecken – und genau darin könnte der Schlüssel für neue Therapien liegen
Dieser Artikel wurde verfasst von Dr. Karin Beyer, Fachärztin für Dermatologie und Venerologie.