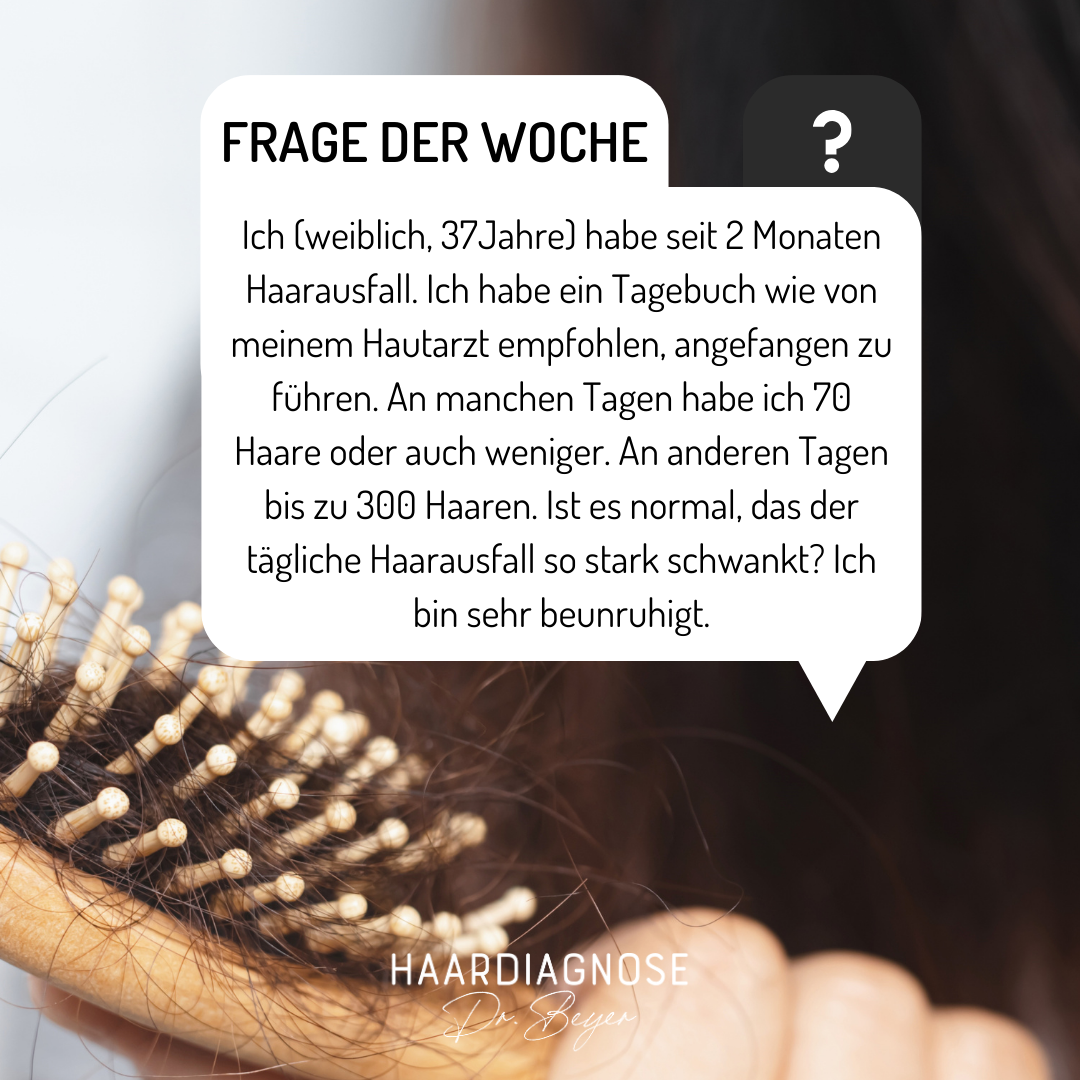Frage der Woche: Ich (weiblich, 37Jahre) habe seit 2 Monaten Haarausfall. Ich habe ein Tagebuch wie von meinem Hautarzt empfohlen, angefangen zu führen. An manchen Tagen habe ich 70 Haare oder auch weniger. An anderen Tagen bis zu 300 Haaren. Ist es normal, das der tägliche Haarausfall so stark schwankt? Ich bin sehr beunruhigt.
Vielen Dank für Ihre Frage – sie wirft wichtige Aspekte auf, die wir systematisch betrachten sollten.
Der ideale Weg zur Diagnostik von Haarausfall basiert auf dem Prinzip des „diagnostischen SET“, also:
1. S – Ihrer Story (Krankengeschichte)
2. E – der Examination (Kopfhautuntersuchung oder Trichoskopie)
3. T – den Tests (Blutuntersuchungen)
Nur wenn wir Informationen aus allen drei Bereichen betrachten, können wir entscheiden, ob Ihr Haarausfall physiologisch, also normal ist, oder Ausdruck einer Erkrankung.
Zu Ihrer Geschichte (Story):
Sie berichten über einen Haarausfall seit 2 Monaten. An manchen Tagen verlieren Sie weniger als 100 Haare, an anderen bis zu 300. Diese Schwankungen können innerhalb des normalen Spektrums liegen.
Die Frage ist jedoch:
• Wie hoch ist der Durchschnitt über mindestens 30 Tage?
• Wie häufig waschen Sie Ihre Haare? (Denn: Je seltener gewaschen wird, desto höher der Verlust am Waschtag.)
Ich würde gerne wissen, welche Blutuntersuchungen bei Ihnen bereits durchgeführt wurden – und wie die Ergebnisse ausgefallen sind. Mich interessiert auch, ob Ihre Menstruationszyklen aktuell regelmäßig verlaufen.
Gibt es bekannte Grunderkrankungen oder Medikamente, die Sie regelmäßig einnehmen? Wie hoch ist Ihr aktueller Stresslevel – beruflich oder privat? Besteht in Ihrer Familie eine Neigung zu Haarausfall?
Ebenso wichtig: Haben Sie Veränderungen an den Augenbrauen oder Wimpern bemerkt? Ist Ihr Körpergewicht in den letzten Monaten stabil geblieben? Haben Sie den Eindruck, dass Ihre Haardichte heute noch der von vor 6 Monaten entspricht – oder hat sie sich sichtbar verändert?
Und schließlich: Bestehen weitere Symptome wie Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen, Hautausschläge, trockene Augen, trockener Mund, übermäßiger Durst, Bauchbeschwerden, Erschöpfung, Libidoveränderungen oder Schleimhautgeschwüre?
All diese Aspekte sind entscheidend, um Ihre Situation ganzheitlich einordnen und die passende Diagnose stellen zu können.
Mit den vorliegenden Informationen lässt sich noch keine abschließende Diagnose stellen. Dafür braucht es eine umfassendere Betrachtung Ihrer Krankengeschichte – idealerweise von A bis Z – sowie eine gezielte Untersuchung der Kopfhaut oder zumindest aussagekräftige Fotos.
Es ist gut möglich, dass Ihr Haarausfall schlicht eine Variante des Normalen darstellt – das sollte immer mitbedacht werden. Viele Menschen mit einer ähnlichen Vorgeschichte wie Ihrer zeigen physiologisches Shedding, also einen Haarausfall, der noch im Rahmen liegt.
Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihre Haardichte mit 37 Jahren noch vergleichbar ist mit der vor zehn oder fünfzehn Jahren – und wenn auch das Ausmaß des Haarausfalls im Alltag nicht deutlich stärker ist als früher, dann spricht viel dafür, dass es sich um eine normale Schwankung handelt.
Falls sich jedoch eine sichtbare Verdünnung zeigt oder der Haarausfall objektiv zugenommen hat, dann sollte weiter untersucht werden, um zu klären, ob der Befund noch im physiologischen Bereich liegt – oder ob eine Haarerkrankung vorliegt.
In Frage kommen hier vor allem:
• Androgenetische Alopezie (AGA)
• Telogenes Effluvium (TE)
• oder eine Kombination aus beidem, was nicht selten ist
Seltenere, aber mögliche Ursachen sind auch:
• Chronisches telogenes Effluvium
• Alopecia areata incognita
• sowie narbige Alopezien
Statistisch betrachtet ist es bei einer Konstellation wie Ihrer am wahrscheinlichsten, dass entweder eine harmlose Variante des Normalen, eine AGA, ein TE oder eine Kombination aus AGA und TE vorliegt.
Die Diagnose lässt sich in den meisten Fällen bereits zuverlässig anhand des zuvor erläuterten S.E.T.-Prinzips stellen – also durch die sorgfältige Kombination aus Anamnese (Story), klinischer Untersuchung (Examination) und gezielter Labordiagnostik (Tests).
1. Normaler Haarausfall – was gilt als „normal“?
Bei gesunden Erwachsenen liegt der tägliche Haarverlust im Durchschnitt bei 20 bis 80 Haaren pro Tag – vorausgesetzt, es wird täglich gewaschen. Je seltener das Haar gewaschen wird, desto höher kann die Zahl an ausgefallenen Haaren an Waschtagen sein – ohne dass dies krankhaft sein muss.
Beispiel:
• Bei Haarwäsche alle zwei Tage können 40–160 Haare ausfallen.
• Bei Haarwäsche alle drei Tage ist ein Verlust von mehreren Hundert Haaren am Waschtag physiologisch völlig unauffällig.
• Wer nur einmal pro Woche wäscht, kann problemlos 400–500 Haare an diesem Tag verlieren – das ist kein Grund zur Besorgnis.
Denn: Die meisten Haare verlieren wir beim Waschen und Kämmen, nicht in Ruhephasen.
Auch zyklusabhängige Schwankungen sind bei Frauen völlig normal – etwa nach dem Eisprung oder kurz vor der Menstruation. Andere individuelle Muster sind ebenfalls möglich.
Fazit: Einzelne hohe Tageswerte sind nicht automatisch pathologisch – entscheidend ist der langfristige Durchschnitt, die Haardichte und das klinische Gesamtbild.
2. Haarausfall bei krankhaften Ursachen – nicht jeder vermehrte Ausfall ist ein Effluvium. Auch krankhafte Haarerkrankungen können mit vermehrtem Haarausfall einhergehen.
Beim telogenen Effluvium (TE) ist der Ausfall meist deutlich, aber nur vorübergehend. Manche verlieren nur leicht überdurchschnittlich viele Haare, andere zeitweise mehrere Hundert pro Tag.
Im Gegensatz dazu verläuft der Haarverlust bei der androgenetischen Alopezie (AGA) oft unauffällig – mit nur leicht erhöhtem Shedding, aber schleichender Ausdünnung der Haardichte, besonders im Scheitelbereich.
Wichtig:
AGA ist eine der häufigsten Ursachen für chronischen Haarausfall bei Frauen – wird aber häufig übersehen.
Zu oft wird vorschnell von „stressbedingtem Effluvium“ ausgegangen, obwohl AGA immer in der Differenzialdiagnose berücksichtigt werden sollte.
3. Die Länge der ausgefallenen Haare liefert wichtige Hinweise
Nicht nur die Anzahl, sondern auch die Länge und Art der ausgefallenen Haare geben wichtige Hinweise auf die Ursache des Haarausfalls.
Ein geringer Anteil kürzerer Haare ist normal.
Fallen jedoch auffallend viele Haare unter 3 cm aus – ohne Zeichen eines Haarbruchs – kann das auf eine Miniaturisierung der Follikel im Rahmen einer androgenetischen Alopezie (AGA) hinweisen.
Insbesondere bei einem Anteil von über 20–30 % kurzer Haare im Tagesverlust und begleitender Scheitelausdünnung sollte AGA abgeklärt werden.
Ein modifizierter Haarwaschtest über 5 Tage kann helfen, diese Verteilung objektiv zu beurteilen.
4. Auch die Art der ausgefallenen Haare ist diagnostisch relevant – nicht jedes lange Haar bedeutet das Gleiche:
• Telogene Terminalhaare fallen am Ende ihres natürlichen Zyklus aus – ganz normal.
• Anagene Haare sollten sich in der Wachstumsphase befinden – ihr Verlust kann auf tieferliegende Störungen hindeuten.
• Dystrophische Anagenhaare weisen auf Entzündungsprozesse hin – z. B. bei Alopecia areata oder narbigen Alopezien.
• Abgebrochene Haare deuten auf mechanische Schädigung, thermische Belastung oder auch Trichotillomanie hin.
Wenn vermehrt abgebrochene, deformierte oder unreife Haare im Ausfall vorkommen, sollte die Diagnostik durch Trichoskopie und ggf. Biopsie ergänzt werden.
Besonders bei ungeklärtem Haarbruch oder Verlust dystrophischer Haare müssen entzündliche und vernarbende Haarerkrankungen ernsthaft in Betracht gezogen werden.
5. Die Verteilung des Haarausfalls liefert wertvolle Hinweise auf die Ursache
Die Verteilung des Haarausfalls liefert wichtige diagnostische Hinweise:
• Ein gleichmäßiger Ausfall über die gesamte Kopfhaut spricht eher für ein telogenes Effluvium (TE).
• Eine betonte Ausdünnung im Scheitelbereich oder an den Schläfen, bei erhaltenem Haarkranz, deutet dagegen oft auf eine androgenetische Alopezie (AGA) hin.
Merke:
Wenn eine Patientin gezielt eine betroffene Stelle benennen kann, sollte AGA – ggf. in Kombination mit TE – immer mitgedacht werden.
6. Symptome der Kopfhaut können Hinweise auf entzündliche Ursachen geben
Auch Kopfhautsymptome geben wertvolle Hinweise auf die Ursache des Haarausfalls:
• Bei AGA und TE können gelegentlich leichter Juckreiz oder Spannungsgefühl auftreten – meist jedoch ohne Krankheitswert.
• Starker Juckreiz, Brennen oder Schmerzen sind dagegen nicht typischfür AGA oder TE und deuten eher auf entzündliche oder narbige Alopezien hin.
Wenn Patient:innen über intensive, belastende Beschwerden berichten – etwa das Bedürfnis, die Kopfhaut zu kühlen – sollten Erkrankungen wie Lichen planopilaris, Frontal fibrosing alopecia, discoider Lupus oder auch Kontaktallergien in Betracht gezogen werden.
7. Körperhaare, Wimpern und Augenbrauen: weitere wichtige Beobachtungsmerkmale
Auch der Verlust anderer Körperhaare kann wichtige Hinweise liefern:
• Bei androgenetischer Alopezie (AGA) ist in der Regel nur die Kopfhaut betroffen – Augenbrauen, Wimpern und Körperbehaarung bleiben erhalten.
• Ein plötzlicher oder fortschreitender Verlust von Augenbrauen, Wimpern oder Körperhaaren kann dagegen auf autoimmunbedingte Erkrankungen hinweisen–etwa auf Alopecia areata oder Frontal fibrosing alopecia (FFA).
Wichtig: Ein altersbedingter oder kosmetisch bedingter Rückgang der Augenbrauen ist häufig und schließt das Vorliegen einer AGA nicht aus – Mischbilder sind möglich.
ZUSAMMENFASSUNG
Folgende Fragen helfen:
• Welche Längen und Typen von Haaren gehen verloren?
• Gibt es Bereiche der Kopfhaut, in denen die Dichte messbar abgenommen hat?
• Treten begleitende Symptome auf – wie Juckreiz, Brennen, Schmerz oder Spannungsgefühl?
Durch diese gezielte Selbstbeobachtung in Kombination mit einer trichologischen Untersuchung lässt sich oft gut abschätzen, ob sich der Haarverlust im Rahmen physiologischer Schwankungen bewegt oder ob Hinweise auf eine behandlungsbedürftige Haarerkrankung bestehen – etwa eine androgenetische Alopezie, ein telogenes Effluvium oder eine andere Ursache.
Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihre Haardichte heute nicht wesentlich anders ist als mit 27 oder 17 Jahren, liegt sehr wahrscheinlich eine normale Form der Haarzyklenvariation vor – eine Variante des Normalen, die keine Behandlung erfordert.
Und genau das ist oft die wichtigste Frage, die gemeinsam geklärt werden muss.
Dieser Artikel wurde verfasst von Dr. Karin Beyer, Fachärztin für Dermatologie und Venerologie.