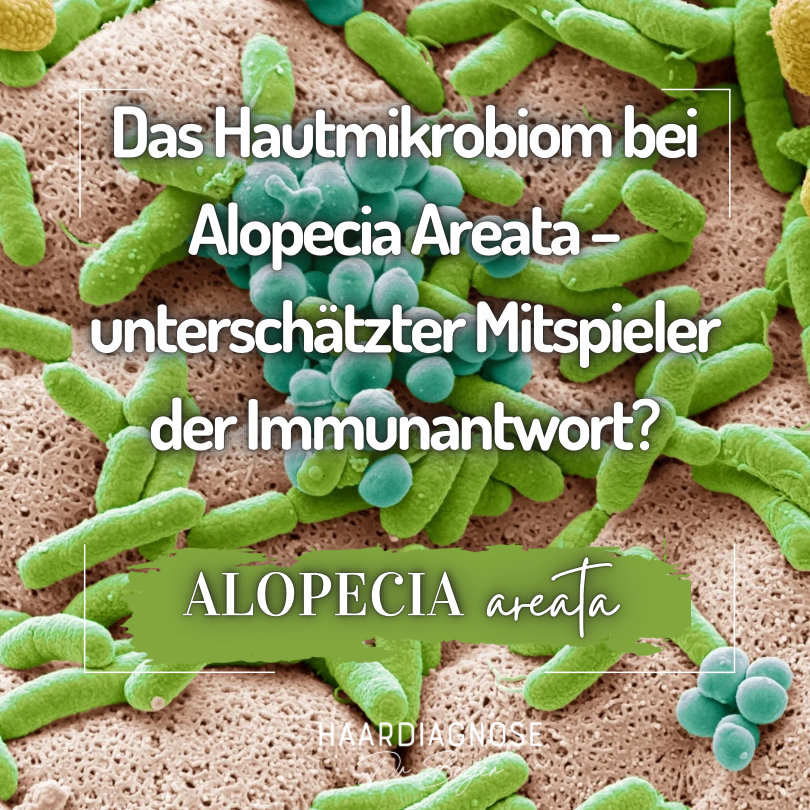Das Hautmikrobiom bei Alopecia Areata – unterschätzter Mitspieler der Immunantwort?
Die Rolle des Hautmikrobioms bei Autoimmunerkrankungen rückt zunehmend in den Fokus – auch bei Alopecia Areata (AA). Während genetische und immunologische Faktoren gut untersucht sind, zeigt sich in neueren Studien: Die Zusammensetzung der Hautflora könnte Einfluss auf das Auftreten, den Schweregrad und das Therapieansprechen von AA haben.
Was zeigen aktuelle Studien?
Bereits 2019 untersuchten Pinto et al. die mikrobielle Zusammensetzung von Haarfollikeln mittels 16S-rRNA-Sequenzierung. Ergebnis: Bei Patient:innen mit AA war Cutibacterium acnes reduziert, während Corynebacterium und Staphylococcus vermehrt nachgewiesen wurden. Diese Veränderungen könnten entzündungsfördernd wirken oder die natürliche Immunbalance in der Haarumgebung stören.
Wang et al. (2021) analysierten Hautabstriche von 20 AA-Betroffenen und 10 Kontrollen. Auch hier war Corynebacterium deutlich häufiger bei Patient:innen mit AA vertreten – ein mögliches Bindeglied zwischen Mikrobiomveränderung und immunvermittelter Follikeldestruktion.
Eine japanische Studie von Morimoto et al. (2019) fand bei schwer betroffenen AA-Patient:innen eine insgesamt veränderte mikrobielle Diversität. Staphylococcus epidermidis, normalerweise ein Kommensale, war bei diesen Patient:innen häufiger nachweisbar – möglicherweise als Reaktion auf eine gestörte Hautbarriere oder lokale Immunveränderung.
Alakesh et al. (2022) gingen einen Schritt weiter: In einer bioinformatischen Analyse kombinierten sie Daten zu Protein-Protein-Interaktionen (PPI), Signalwegen (KEGG) und Genfunktionen (GO). Ergebnis: Es gibt Hinweise auf mikrobiell beeinflusste Signalwege, die direkt in die Pathogenese der AA eingreifen könnten – etwa über die Modulation der T-Zell-Aktivierung.
Die Übersichtsarbeit von Sánchez-Pellicer et al. (2022) fasst diese und weitere Daten systematisch zusammen: Unterschiede im Hautmikrobiom, möglicherweise auch im Darmmikrobiom, könnten den Verlauf, die Schwere und sogar das Ansprechen auf Therapien bei AA beeinflussen.
Was bedeutet das für die Praxis?
• Es besteht kein klarer Kausalzusammenhang, aber die Assoziationen sind reproduzierbar und immunologisch plausibel.
• Corynebacterium und Staphylococcus treten bei vielen AA-Patient:innen überrepräsentiert auf – potenziell als Trigger, Verstärker oder Folge einer bereits gestörten Immunantwort.
• Das Mikrobiom könnte künftig ein neues therapeutisches Ziel darstellen – z. B. durch Probiotika, topische Mikrobiom-Modulatoren, barrierestabilisierende Pflege oder gezielte Reinigungstherapien.
• Weitere Studien sind nötig, aber der Weg zu individualisierten Mikrobiom-Therapien bei AA ist eröffnet.
Quellen:
• Pinto D. et al., Journal of Dermatological Science, 2019
• Wang Y. et al., Annals of Dermatology, 2021
• Morimoto K. et al., Journal of Dermatology, 2019
• Alakesh A. et al., International Journal of Molecular Sciences, 2022
• Sánchez-Pellicer P. et al., Genes, 2022; 13(10):1680 https://doi.org/10.3390/genes13101680
Fazit:
Das Hautmikrobiom ist kein bloßer Mitläufer – sondern möglicherweise ein aktiver Mitspieler in der Immunpathogenese der Alopecia Areata.
Noch ist vieles unklar. Aber schon heute kann die Mikrobiom-Perspektive helfen, neue Strategien zur Unterstützung der Hautbarriere und Immunbalance zu entwickeln.
Dieser Artikel wurde verfasst von Dr. Karin Beyer, Fachärztin für Dermatologie und Venerologie.