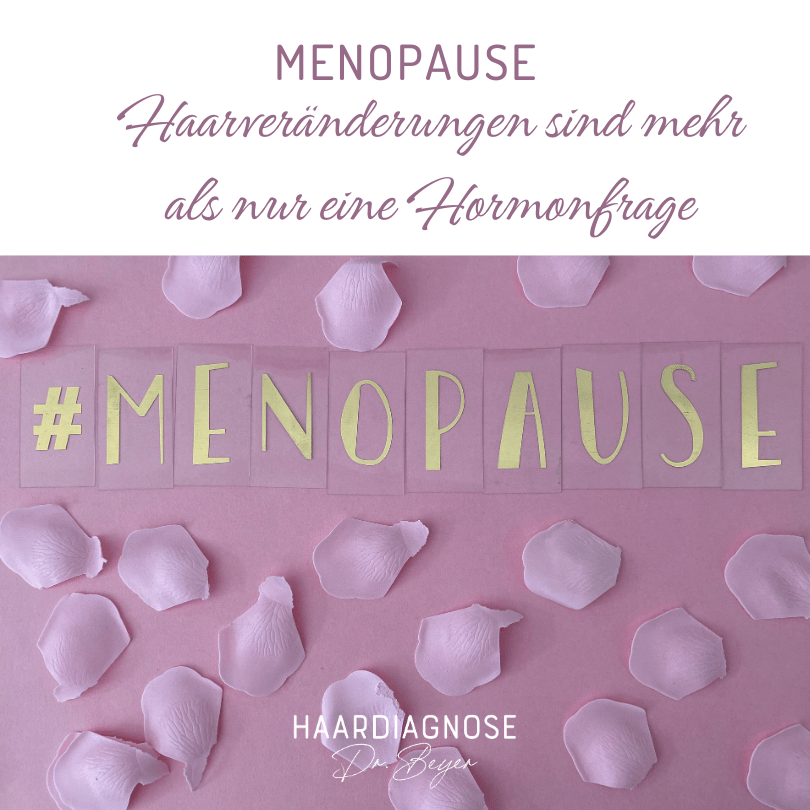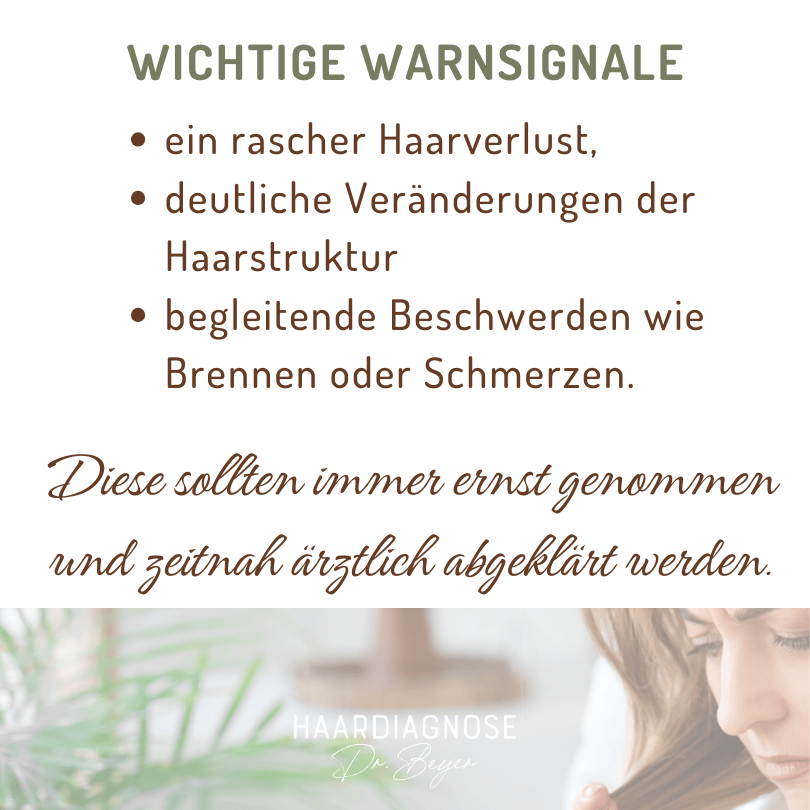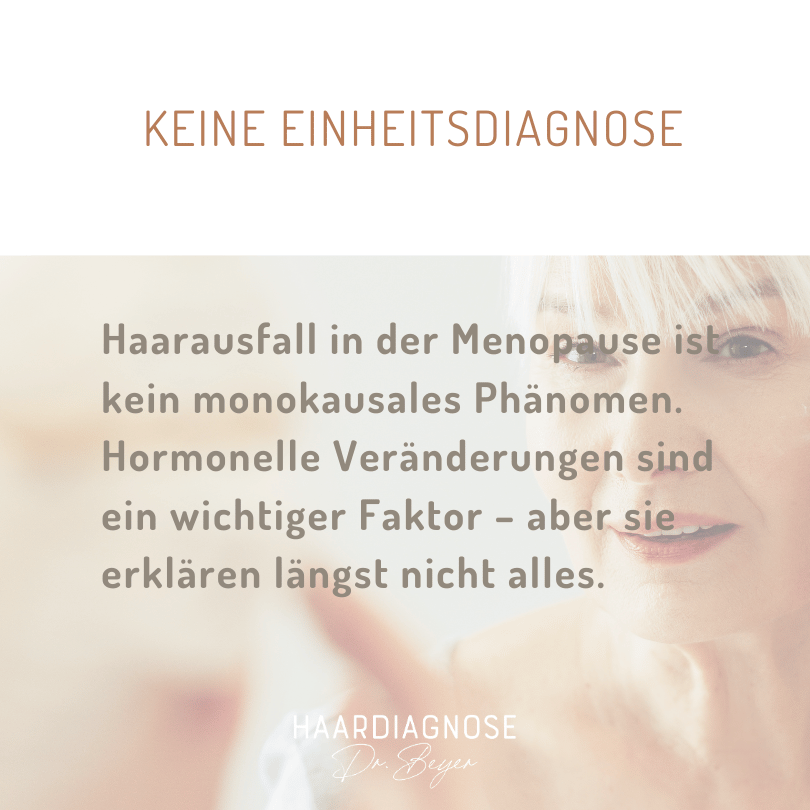Menopause: Haarveränderungen sind mehr als nur Hormonfrage
Im Gehirn steuert die Hypophyse (Hirnanhangdrüse) viele Körperfunktionen. Besonders wichtig für die Wechseljahre ist das Follikelstimulierende Hormon (FSH), das im Vorderlappen gebildet wird.
FSH reguliert die Hormonproduktion in den Eierstöcken. Je näher eine Frau der Menopause kommt, desto stärker steigt der FSH-Wert an – ein Hinweis darauf, dass die Eierstockfunktion nachlässt. Nach der Menopause bleibt er dauerhaft erhöht.
Was sich mit der Menopause verändert
Mit der Menopause sinkt der Östrogenspiegel deutlich. Vor der Menopause haben Frauen im Haarfollikel:
• Weniger 5-Alpha-Reduktase (Enzym, das Testosteron in DHT umwandelt)
• Mehr Aromatase (Enzym, das Androgene in Östrogene umwandelt)
Beides wirkt schützend für die Haarfollikel. Nach der Menopause fällt dieser Schutz teilweise weg. Die genetische Veranlagung zu Haarverlust wird sichtbarer – selbst wenn die Blutwerte für Testosteron oder DHEA-S unauffällig sind.
Häufige Formen von Haarausfall in und nach der Menopause
- Androgenetische Alopezie (Female Pattern Hair Loss) – häufigste Form, durch hormonelle Umstellung beschleunigt, gleichmäßige Ausdünnung am Oberkopf ohne vollständige Glatzenbildung.
- Telogenes Effluvium – verstärkter Haarwechsel mit diffusem Ausfall; Auslöser sind hormonelle Schwankungen, Stress, Schilddrüsenerkrankungen oder Nährstoffmängel.
- Vernarbende Formen – z. B. Frontal Fibrosing Alopecia (FFA) oder Lichen planopilaris (LPP), häufiger im postmenopausalen Alter, wahrscheinlich hormonell und immunologisch mitbedingt.
- Schilddrüsenbedingter Haarausfall – Unter- oder Überfunktion der Schilddrüse, in den Wechseljahren nicht selten.
- Nährstoffmangel-bedingter Haarausfall – Eisen-, Zink- oder Eiweißmangel, oft durch veränderte Ernährung oder Resorptionsstörungen.
Weitere Einflussfaktoren
• Veränderungen der Schilddrüsenfunktion
• Stoffwechselumstellungen
• Chronische Erkrankungen
• Medikamente, insbesondere Brustkrebstherapien: Aromatasehemmer (z. B. Letrozol) – Haarausfall bei bis zu 25 % Tamoxifen – Haarausfall bei bis zu 10 %
• Pilzinfektionen der Kopfhaut (Tinea capitis) – zweiter Erkrankungsgipfel im postmenopausalen Alter
Typische Veränderungen an Haaren und Kopfhaut
• Verminderte Haardichte
• Feiner und kürzer werdende Haare (Miniaturisierung)
• Trockenheit und Brüchigkeit durch geringere Talgproduktion
• Rauere, strohigere Haarstruktur
• Mitunter vermehrter Flaum im Gesicht
• Ausdünnung von Augenbrauen und Wimpern
• Empfindlichere Kopfhaut
Psychologische Aspekte
Typische Veränderungen an Haaren und Kopfhaut
• Verminderte Haardichte
• Feiner und kürzer werdende Haare (Miniaturisierung)
• Trockenheit und Brüchigkeit durch geringere Talgproduktion
• Rauere, strohigere Haarstruktur
• Mitunter vermehrter Flaum im Gesicht
• Ausdünnung von Augenbrauen und Wimpern
• Empfindlichere Kopfhaut
Psychologische Aspekte
Haarveränderungen in und nach den Wechseljahren sind weit verbreitet, werden aber oft als individuell belastend empfunden.
Zu wissen, dass diese Veränderungen häufig, erklärbar und multifaktoriell bedingt sind, kann entlastend wirken.
Eine sorgfältige Diagnose ist die Grundlage jeder sinnvollen Beratung und Therapieentscheidung. Dabei gilt: Je spezifischer die Erfahrung des Arztes oder der Ärztin im Bereich Haarausfall, desto zielgerichteter kann die Abklärung erfolgen.
Eine präzise Abklärung ist die Grundlage jeder Behandlung:
• Ausführliche Anamnese: Beginn, Verlauf, Auslöser, Familienanamnese, Medikamente, Begleiterkrankungen, Haarpflege- und Färbegewohnheiten.
• Klinische Untersuchung und Trichoskopie: Beurteilung der Haardichte, -struktur und möglicher Kopfhautveränderungen (Rötungen, Schuppen, Follikelveränderungen, Narben).
• Laboruntersuchungen:
• Blutbild , Schilddrüsenparameter, Eisenstoffwechsel (Ferritin), Vitamin D bei weiteren Hinweisen: • Vitamin B12 und Folsäure Zink, ggf. Selen Hormonprofil
• Allergologische Testung: Epikutantests bei Verdacht auf Kontaktallergie der Kopfhaut.
• Kopfhautbiopsie: bei Verdacht auf vernarbende Alopezien oder unklaren Befunden.
Wichtige Warnsignale sind ein rascher Haarverlust, deutliche Veränderungen der Haarstruktur oder begleitende Beschwerden wie Brennen oder Schmerzen. Diese sollten immer ernst genommen und zeitnah ärztlich abgeklärt werden.
Es gibt keine „Einheitsdiagnose“ – jede Patientin wird individuell betrachtet. Ziel ist es, den genauen Mechanismus des Haarverlusts zu verstehen. Eine familiäre Häufung kann Hinweise geben, ersetzt aber nicht die Untersuchung. Erst nach einer vollständigen Abklärung lässt sich ein gezieltes Vorgehen empfehlen.
Haarausfall in den Wechseljahren ist nicht nur eine Hormonfrage. Viele Faktoren spielen zusammen – und jede Frau ist individuell betroffen.
Für mehr Informationen zur Menopause (nicht nur rund ums Haar, sondern auch zu Haut, Knochen, Stimmung, Schlaf & Gesundheit) lohnt sich ein Blick auf menoQueens – eine Plattform, die Frauen in dieser Lebensphase mit Wissen & Austausch begleitet..
Dieser Artikel wurde verfasst von Dr. Karin Beyer, Fachärztin für Dermatologie und Venerologie.