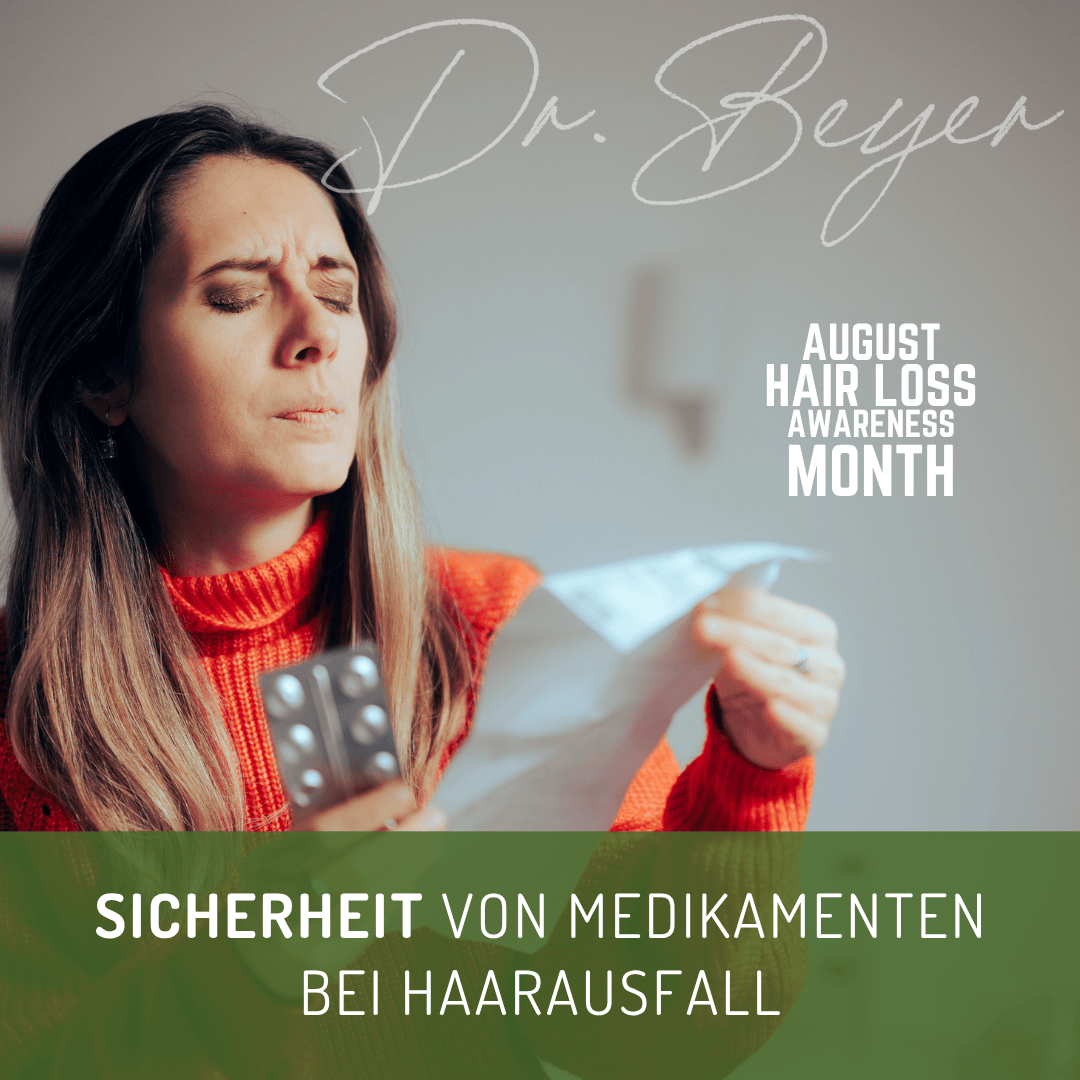Behandlungen gegen Haarausfall: Warum uns „Beipackzettel“ oft mehr beunruhigen als helfen – und wie man Nebenwirkungen besser einordnen kann
Informationen über Medikamente sollen aufklären, Risiken benennen und Patientensicherheit erhöhen. Doch viele Patient:innen mit Haarerkrankungen fühlen sich nach der Lektüre eines Beipackzettels eher verunsichert als gut informiert. Der Grund: Die Nebenwirkungslisten lesen sich oft dramatischer als die Erkrankung selbst – und lassen dabei wichtige Einordnungen vermissen.
Wer sich beispielsweise über Minoxidil, Finasterid oder Quensyl informiert, liest Begriffe wie Herzrasen, Depression, Impotenz oder Sehstörungen. Nicht selten entstehen daraus Ängste, die zu einem Therapieabbruch oder gar dazu führen, dass eine wirksame Behandlung gar nicht erst begonnen wird.
Doch wie realistisch sind diese Nebenwirkungen – und wie lassen sie sich im Verhältnis zum Nutzen bewerten?
Warum Beipackzettel mehr verunsichern als differenzieren
Der erste Grund liegt im sogenannten „regulatorischen Konservatismus“. Beipackzettel unterliegen strengen rechtlichen Vorgaben. Sobald eine Nebenwirkung einmal gemeldet wurde, muss sie aufgenommen werden – auch dann, wenn sich später kein ursächlicher Zusammenhang bestätigt. Viele Symptome bleiben dauerhaft gelistet, obwohl sie in kontrollierten Studien nicht häufiger auftreten als unter Placebo.
Ein zweites Problem ist, dass keine Unterscheidung zwischen zufälligen Beschwerden und tatsächlich durch das Medikament verursachten Symptomen erfolgt. Auch Nebenwirkungen, die ebenso häufig in der Placebo-Gruppe aufgetreten sind, erscheinen im Beipackzettel – ohne Hinweis auf diese wichtige Unterscheidung.
Und schließlich spielt ein psychologischer Effekt eine große Rolle: der sogenannte Nocebo-Effekt. Studien zeigen, dass die Erwartung von Nebenwirkungen deren Auftreten deutlich wahrscheinlicher macht. Besonders gut belegt ist dies bei Finasterid. Eine randomisierte Studie (Zhang et al., 2023) konnte zeigen, dass Männer, die explizit vor sexuellen Nebenwirkungen gewarnt wurden, diese doppelt so häufig berichteten – obwohl die tatsächliche Wirkung des Medikaments identisch war. Erwartung beeinflusst Wahrnehmung – und das sollte in der Aufklärung berücksichtigt werden.
Wie häufig ist „häufig“ – und wie kann man es besser verstehen?
Die meisten Beipackzettel verwenden Begriffe wie „sehr häufig“, „häufig“, „gelegentlich“ oder „selten“. Doch was bedeuten diese Angaben eigentlich?
• Sehr häufig: betrifft mehr als 10 von 100 Personen. Zum Vergleich: So häufig wie ein abgeplatzter Knopf an Hemd oder Hose. Es passiert nicht jedem – aber fast jede*r kennt es.
• Häufig: 1 bis 10 von 100 Personen – ähnlich wie das Risiko, im Winter auf Glatteis auszurutschen.
• Gelegentlich: 1 bis 10 von 1.000 – etwa so wahrscheinlich wie ein verlorener Koffer auf einer Flugreise.
• Selten: 1 bis 10 von 10.000 – vergleichbar mit einem Stromausfall beim Zahnarztbesuch.
Solche Vergleiche helfen, Risiken realistisch einzuordnen. Noch hilfreicher wäre es, Nebenwirkungen auch positiv zu formulieren – zum Beispiel: „90 von 100 Patient:innen berichten keine Nebenwirkungen“ statt „Nebenwirkung: häufig“.
Die oft vergessene Seite: Was passiert, wenn man nicht behandelt?
Bei der Bewertung von Medikamenten konzentrieren wir uns häufig auf deren Risiken – und vergessen dabei die Nebenwirkungen der unbehandelten Erkrankung. Gerade in der Trichologie sind diese nicht zu unterschätzen:
• Alopecia areata kann ohne Therapie chronisch verlaufen und sich zur Totalis oder Universalis ausweiten – mit erheblichen psychischen Folgen.
• Vernarbende Alopezien wie FFA oder LPP führen unbehandelt zu irreversibler Zerstörung der Haarfollikel, entzündlicher Aktivität, Schmerzen und Narbenbildung.
• Androgenetische Alopezie (AGA) schreitet meist langsam, aber stetig voran. Wird sie nicht behandelt, gehen immer mehr terminale Haare verloren – und der therapeutische Spielraum wird kleiner.
Die entscheidende Frage ist daher nicht: „Hat dieses Medikament Nebenwirkungen?“, sondern: „Wie steht das Risiko der Behandlung im Verhältnis zum Risiko der Nichtbehandlung?“
Wie häufig sind relevante Nebenwirkungen – und wie wahrscheinlich ist der Nutzen?
Kortison (topisch oder als Injektion)
Topisches Kortison ist gut verträglich, wenn es zeitlich begrenzt und unter ärztlicher Kontrolle angewendet wird. Risiken wie Hautverdünnung oder Teleangiektasien sind bei intermittierender Anwendung an der Kopfhaut selten.
Intraläsionale Kortisoninjektionen gelten als evidenzbasierte Therapien bei Alopecia areata. In Studien erzielen 60–75 % der behandelten Patient:innen innerhalb von 1–3 Sitzungen einen deutlichen Haarwuchs. Bei vernarbenden Alopezien (v. a. FFA und LPP) helfen sie, entzündliche Aktivität zu dämpfen und Symptome wie Brennen oder Schmerzen zu lindern. Lokale Nebenwirkungen (z. B. Hautvertiefungen) treten in weniger als 5 % der Fälle auf.
Hydroxychloroquin (Quensyl®)
Quensyl wird bei FFA und LPP eingesetzt, um die Autoimmunaktivität zu modulieren. Etwa 40–60 % der Patient:innen zeigen unter Therapie eine klinische Stabilisierung oder Rückbildung der Entzündung.
Die häufigsten Nebenwirkungen sind Magen-Darm-Beschwerden, die in etwa 10–15 % der Fälle auftreten und meist gut durch Einnahme zu den Mahlzeiten kontrollierbar sind. Das gefürchtete Risiko einer Netzhautschädigung betrifft laut Studien weniger als 1 % der Patient:innen bei korrekter Dosierung (nicht über 5 mg/kg Körpergewicht) und regelmäßiger augenärztlicher Kontrolle. Das bedeutet: Bei verantwortungsvoller Anwendung ist das Netzhautrisiko sehr gering.
Topisches Minoxidil (1–5 %) ist in der Behandlung der AGA etabliert. Es kann initial ein vorübergehendes „Shedding“ auslösen – was paradox klingt, aber als Zeichen des Ansprechens gilt. Hautreizungen sind selten.
Die orale Anwendung in niedriger Dosierung (Low Dose Oral Minoxidil, z. B. 0,25–2,5 mg täglich) wird zunehmend evidenzbasiert eingesetzt, insbesondere bei Frauen mit AGA oder schwer behandelbaren Fällen. Die Verträglichkeit ist in Studien gut: Die häufigsten Nebenwirkungen sind feine Körperbehaarung oder leichtes Herzklopfen – meist reversibel und dosisabhängig. Relevante kardiovaskuläre Komplikationen traten in Studien bei unter 2 % der Patient:innen auf. Die Ansprechrate liegt – je nach Studie – bei 60–80 %.
Finasterid
Finasterid ist bei Männern mit AGA zugelassen, bei Frauen (z. B. postmenopausal) wird es off-label eingesetzt. Die Wirksamkeit ist gut belegt: In Langzeitstudien kam es bei 80–90 % der Patienten zu Stabilisierung, bei etwa 60 % auch zu sichtbarer Verdichtung.
Sexuelle Nebenwirkungen (z. B. Libidoverlust, Erektionsstörungen) treten in 1–2 % der Fälle auf – das bedeutet: 98 von 100 Männern berichten keine diesbezüglichen Beschwerden. Wie oben erwähnt, spielt hier der Nocebo-Effekt eine große Rolle – die bloße Erwartung kann das Risiko verdoppeln. Wichtig ist eine realistische Aufklärung mit Einordnung der Zahlen.
Doxycyclin
Doxycyclin ist kein typisches „Haarmedikament“, wird aber bei vernarbenden Alopezien wegen seiner antientzündlichen Wirkung eingesetzt. Gerade bei FFA oder LPP dient es häufig als Einsteigermedikation. Die Studienlage ist gemischt, aber in der Praxis berichten etwa 40–60 % der Betroffenen über Stabilisierung und Rückgang entzündlicher Symptome.
Die Verträglichkeit ist insgesamt gut. Häufigste Nebenwirkung ist eine erhöhte Lichtempfindlichkeit, insbesondere bei hoher UV-Exposition. Bei Einnahme mit dem Essen lassen sich Magenbeschwerden meist vermeiden. Schwere Nebenwirkungen sind selten.
JAK-Inhibitoren (z. B. Baricitinib, Ritlecitinib)
JAK-Inhibitoren (z. B. Baricitinib, Ritlecitinib) werden bei schwerer Alopecia areata eingesetzt, um die fehlgesteuerte Immunreaktion gezielt zu hemmen. In klinischen Studien zeigten 60–80 % der Patient:innen unter Therapie ein deutliches Nachwachsen der Haare, bei einem Teil sogar eine vollständige Remission.
Die häufigsten Nebenwirkungen sind Infekte der oberen Atemwege, Kopfschmerzen oder Akne. Diese treten bei etwa 10–20 % der Patient:innen auf und sind in der Regel mild und gut behandelbar. Einzelne berichten über vorübergehende Magen-Darm-Beschwerden oder leichte Gewichtszunahme.Ein leicht erhöhtes Risiko für Gürtelrose (Herpes Zoster) ist beschrieben – insbesondere bei älteren Patient:innen oder bei zusätzlicher Immunsuppression. Bei entsprechender Risikokonstellation (z. B. ab 50 Jahren) kann eine Impfung vor Therapiebeginn sinnvoll sein.
Was den Warnhinweis zu schwerwiegenden Risiken wie Thrombosen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Malignomen betrifft, basieren diese Hinweise auf der ORAL Surveillance-Studie zu Tofacitinib bei rheumatoider Arthritis – einer älteren, vorerkrankten Population mit hoher Komedikation (Methotrexat, Glukokortikoide).
Für junge, ansonsten gesunde Menschen mit Alopecia areata sind diese Risiken nicht einfach übertragbar. Aktuelle Kohortendaten aus der Dermatologie zeigen bislang kein erhöhtes Risiko für venöse Thrombosen oder Malignome bei Anwendung von Baricitinib, Abrocitinib oder Upadacitinib in anderen entzündlichen Dermatosen.
Das bedeutet: Bei verantwortungsvoller Anwendung, regelmäßiger Laborkontrolle und sorgfältiger Patientenauswahl ist das Sicherheitsprofil von JAK-Inhibitoren bei AA insgesamt günstig
Was können Patient:innen konkret tun?
1. Lesen Sie selektiv und mit Fokus:
Nicht jede Information ist für Sie relevant. Wichtig sind:
• Warnhinweise bei Schwangerschaft oder Stillzeit
• Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten
• Symptome, bei denen Sie sofort ärztliche Hilfe benötigen (z. B. Atemnot, Hautausschlag mit Schwellung, Sehstörungen)
2. Fragen Sie nach relativen und absoluten Risiken:
• Wie häufig tritt diese Nebenwirkung tatsächlich auf?
• Wie schwerwiegend ist sie im Vergleich zur Erkrankung?
• Gibt es Alternativen?
• Was passiert, wenn ich nicht behandle?
3. Beziehen Sie Ihre Lebenssituation mit ein:
Entscheidungen zu Medikamenten sind individuell. Belastung durch die Erkrankung, berufliche und familiäre Anforderungen, Kinderwunsch oder Vorerkrankungen beeinflussen, was die „richtige“ Therapie ist.
Und wenn Medikamente (noch) keine Option sind?
Dann bleiben Camouflage, Haarverdichtungsprodukte, Toppersysteme oder hochwertige Perücken eine gute, oft entlastende Alternative. Zweithaar kann kosmetisch, aber auch psychisch stabilisierend wirken – und ist kein Ausdruck des Scheiterns, sondern der Selbstfürsorge.
Fazit
Beipackzettel informieren – aber sie tun das meist aus juristischer Sicht, nicht aus klinischer. Für Betroffene mit Haarerkrankungen ist eine individuelle, verständliche und ehrliche Einordnung wichtiger als die reine Aufzählung möglicher Risiken. Denn wer die Wahrscheinlichkeiten kennt, kann besser entscheiden – und Ängste verlieren ihre Macht.
Quellen (Auswahl):
• Zhang et al. (2023): Expectation-induced adverse effects of Finasteride
• Colloca & Miller (2011), Wells & Kaptchuk (2012): Nocebo-Effekte in klinischen Studien
• www.bfarm.de, www.ema.europa.eu
Dieser Artikel wurde verfasst von Dr. Karin Beyer, Fachärztin für Dermatologie und Venerologie.